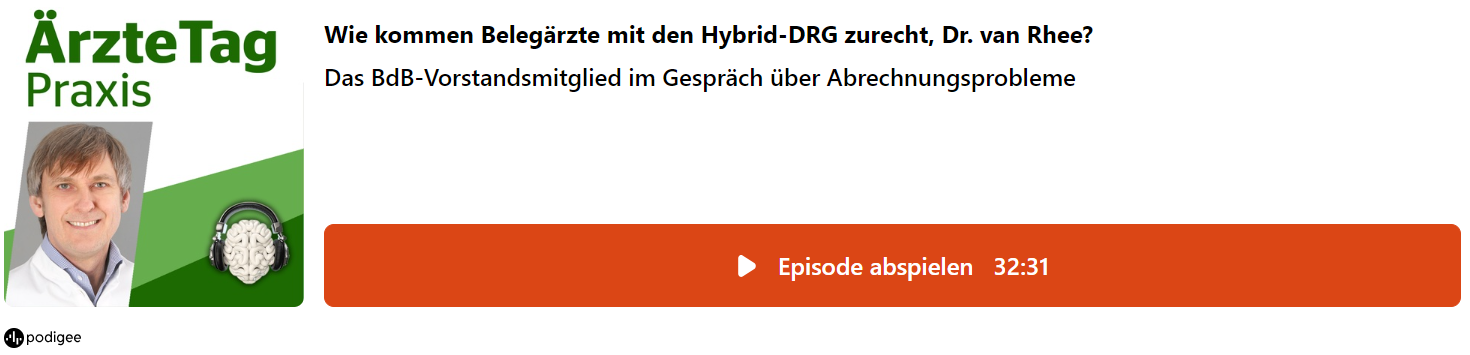Webinar-Einladung
Der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e.V. bietet am 26 Februar von 19 bis 20 Uhr VertragsärztInnen und Ihren MitarbeiterInnen ein hochaktuelles Webinar zum Thema
Hybrid-DRG 2026: Was gibt´s Neues?
Holen Sie sich unter mitgliederverwaltung@bundesverband-belegaerzte.de Ihren Zoom-Link zur Einwahl (Teilnehmerzahl begrenzt), auch als noch-nicht Mitglied.
Geplanter Ablauf:
- Einführung
- H-DRG Vertrag, Abrechnungsmodalitäten und Kontext-Ausschlussfaktoren
- von Diagnose und OPS zur H-DRG
- InEK-Algorithmus – kurz erläutert
- Kodierrichtlinien – was gilt es zu beachten
- Aus den Fachdisziplinen Urologie / Orthopädie / Cardiologie / Chirurgie angefragt / Gastroenterologie angefragt
- Diskussion ausgewählter Chat-Anfragen: Dr. P. Kollenbach
Antworten auf umfangreichere Fragen werden im Nachgang als FAQ zugesandt, sofern Sie Ihre E-Mail-Adresse im Chatbereich eintragen. Die Teilnahme ist für Sie und Ihre Mitarbeitende ist dieses Mal noch kostenlos. Aus Planungsgründen bitten wir dennoch um Ihre Anmeldung über mitgliederverwaltung@bundesverband-belegaerzte.de an unsere Geschäftsstelle.
Unser Partner Sanakey Contract, Management Gesellschaft, bietet die Abrechnung von Hybrid-DRGs und Selektivverträgen an. Hinweis: BdB-Mitgliedern erhalten einen Rabatt auf die Abrechnungsgebühren an. Nähere Informationen hierzu bitte direkt bei Sanakey Contract nachfragen.
Wir freuen uns auf Sie
Beste Grüße
Dr. Peter Kollenbach und Dr. Ryszard van Rhee
Vorsitzende des BdB
DGIV diskutiert „Gesundheit vor Ort“ am 26. März auf dem 22. Bundeskongress in Berlin
Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e. V. (DGIV) lädt am 26. März 2026 zum 22. DGIV-Bundeskongress nach Berlin ein. Unter dem Leitmotiv „Gesundheit vor Ort – Integriert. Interprofessionell. Partizipativ.“ diskutieren Akteurinnen und Akteure aus Politik, Versorgungspraxis, Wissenschaft, Selbstverwaltung und Gesundheitswirtschaft im Hotel Aquino zentrale Fragen einer zukunftsfähigen, regional verankerten Gesundheitsversorgung.
Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage, wie Gesundheitsversorgung stärker an den tatsächlichen Bedarfen der Menschen ausgerichtet und gemeinsam vor Ort gestaltet werden kann. Die DGIV setzt dabei bewusst auf einen Perspektivwechsel: weg von sektoralen Zuständigkeiten, hin zu den Bedürfnissen der Menschen in den Regionen. Partizipation wird dabei nicht als ergänzendes Instrument verstanden, sondern als zentrales Strukturprinzip integrierter Versorgung. Bürgerinnen und Bürger sowie Patientinnen und Patienten werden nicht nur adressiert, sondern als aktive Mitgestalter von Versorgungsstrukturen verstanden. Ohne ihre Perspektiven bleibt integrierte Versorgung unvollständig.
Der Bundeskongress greift zugleich die grundlegenden Herausforderungen des Gesundheitssystems auf – von fragmentierten Zuständigkeiten über Sektorengrenzen bis hin zu regionalen Versorgungsunterschieden. Diskutiert wird, wie integrierte Versorgung die strukturellen Probleme des Gesundheitssystems überwinden kann, wenn interprofessionelle Zusammenarbeit, kommunale Verantwortung, Partizipation und digitale Vernetzung konsequent zusammengedacht und umgesetzt werden. Ziel ist es, konkrete Lösungsansätze sichtbar zu machen und Wege in eine nachhaltige Umsetzung aufzuzeigen. Zahlreiche politische Gäste aus Bundes- und Landespolitik runden das Kongressprogramm ab.
Der DGIV-Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Eckhard Nagel, unterstreicht die Bedeutung des Kongressthemas: „Partizipation eröffnet neue Perspektiven für integrierte Versorgung. Sie hilft, Bedarfe sichtbar zu machen und Versorgungsstrukturen passgenauer auszurichten. Integrierte Versorgung entsteht also nicht durch abstrakte Reformen, sondern nur durch gemeinsame Verantwortung vor Ort“, so Prof. Nagel. Nur so könnten tragfähige neue Strukturen entstehen.
Bereits am Vortag des Kongresses, am 25. März 2026, richtet die DGIV zum fünften Mal ihr traditionelles „Bootcamp für Young Professionals und Studierende“ aus. Im Rahmen des Bootcamps werden aktuelle Herausforderungen des Gesundheitssystems diskutiert und aus der Perspektive des professionellen Nachwuchses Thesen zu einem partizipativen Gesundheitssystem erarbeitet, die in die Diskussionen des Hauptkongresstages einfließen.
Ein besonderer Programmpunkt des diesjährigen Kongresses ist die erstmals durchgeführte Postersession. Sie bietet Raum für praxisnahe Projekte, wissenschaftliche Arbeiten und innovative Versorgungskonzepte und versteht sich ausdrücklich als partizipatives Format. Die vorgestellten Beiträge werden im direkten Austausch diskutiert. Ergänzend verleiht die DGIV einen mit 1.000 Euro dotierten Posterpreis, mit dem herausragende Ansätze zur integrierten und partizipativen Gesundheitsversorgung ausgezeichnet werden.
„Integrierte Versorgung ist eine Voraussetzung für zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. Entscheidend ist, dass sie regional verantwortet, interprofessionell getragen und partizipativ gestaltet wird“, so Prof. Nagel zusammenfassend.
Weitere Informationen zum Bundeskongress der DGIV sowie zum Bootcamp und zur Postersession finden Sie unter: https://dgiv.org/veranstaltung/22-dgiv-bundeskongress-am-26-maerz-2026-in-berlin/
DGIV e.V.
c/o iX – Institut für Gesundheitssystem-Entwicklung
Dr. Albrecht Kloepfer, Wartburgstraße 11, 10823 Berlin
Tel: 030 – 44 72 70 80, Mobil: 0178 784 41 92
dr.kloepfer@dgiv.org, www.dgiv.org
Strategiemeeting und Mitgliederversammlung des BdB in Hannover
Am 29. August 2025 fand das Strategiemeeting des Bundesverbandes der Belegärzte und Belegkrankenhäuser in Hannover statt. Die Mitgliederversammlung des BdB wurde am Folgetag in der Sophienklinik abgehalten.
Neben der Nachlese der in den vergangenen Wochen wahrgenommenen politischen Kontakte wurde die Agenda der Lobbyarbeit für das Belegarztwesen bis zum Jahresende und darüber hinaus festgezurrt. Dabei wurden auch grundsätzliche Überlegungen zum Umgang mit Entscheidungsgremien, wie z.B. der KBV, erörtert und entsprechende Vorgehensweisen beschlossen.
Stand 3.9.25
A K T U E L L - - - - A K T U E L L - - - - A K T U E L L- - - - A K T U E L L
Erstattung von Kosten für den ärztlichen Bereitschaftsdienst und die von Belegärzten veranlassten ärztlichen Assistenzleistungen
Belegabteilungen arbeiten effizient und müssen wie alle Betriebe, die am Ende des Jahres nicht aus Steuergeldern subventioniert werden, vor dem Hintergrund steigender Kosten zumindest eine „schwarze Null“ erwirtschaften. Gerade in den derzeit unsicheren Zeiten und bei steigenden Kosten sollten alle Ressourcen zur Existenzsicherung von Belegabteilungen genutzt werden. Dabei rückt die Finanzierung des ärztlichen Dienstes in Belegkliniken in den Fokus.
Gemäß den unverändert bestehenden gesetzlichen Regelungen in §121 Sozialgesetzbuch (SGB V) muss der ärztliche Dienst „leistungsgerecht“ vergütet werden. In §39 Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) wird explizit die Erstattung der Kosten für den ärztlichen Bereitschaftsdienst durch die Kostenträger und schlussendlich über die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) auf Landesebene geregelt.
Nach unserer Kenntnis gibt es bundesweit kaum Belegärzte, denen die Kostenträger den Bereitschaftsdienst nach Kostennachweis vollständig erstatten. Sollten Sie jemanden mit einer solchen Regelung kennen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Teils erhalten Belegärzte über die KVen auf der Basis einer Pseudoziffer einen pauschalierten, vor vielen Jahren ermittelten und lange nicht mehr an die aktuelle Kostensteigerung angepassten Standardbetrag pro Patient und Liegetag. Diese Regelung bildet nicht den tatsächlich entstehenden Personalkostenblock für den ärztlichen Dienst ab. Sie ist zudem in Anbetracht der sinkenden Belegung als Folge der Ambulantisierung immer weniger in der Lage, die tatsächlichen Kosten zu decken. Teils finanzieren Belegabteilungen selbst oder etwaige in demselben Krankenhaus befindliche Hauptabteilungen den belegärztlichen Bereitschaftsdienst quer. Ein solches Verfahren entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und ist auch aus wirtschaftlichen Gründen vielerorts nicht mehr praktizierbar.
Folgende „Dienstarten“ können in einer Belegabteilung optional vorkommen:
Mitglied werden und ganzen Artikel lesen
Stand 14.7.25
Mitgliederschreiben
Schreiben an die Mitglieder zur aktuellen politischen Lage des Belegarztwesens und dringende Handlungsempfehlung
Stand 5.5.25
BMG Schreiben: KHVVG und Belegarztwesen
Das Bundesgesundheitsministerium hat auf unsere Bemühungen reagiert und unsere Auffassung bestätigt, dass der Gesetzesterminus Vollzeitäquivalente nicht auf belegärztliche Versorgung anwendbar ist.
Stand 14.3.25
Belegärzte sehen wegen Klinikreform ihre Existenz gefährdet
Bei der Umsetzung der Klinikreform liegt der Teufel im Detail: Ob es um diverse Verordnungen geht, die zeitnah kommen, oder um Zeitvorgaben. Zum Beispiel sehen sich Belegärzte mit handfesten Problemen konfrontiert.
Stand 24.2.25
Unklare Formulierung im KHVVG gefährdet den Fortbestand des Belegarztwesens
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Belegarztwesen ist die Urform intersektoraler Versorgungsstrukturen.
Es ist seit Jahrzehnten bewährt, rechtssicher und ausgesprochen patientenfreundlich. Belegärztinnen und Belegärzte arbeiten als Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowohl ambulant als auch stationär. Dabei tragen Belegabteilungen überdurchschnittlich häufig zur qualifizierten fachärztlichen Versorgung ländlicher Regionen bei.
Stand 20.1.25
Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser erreicht den Erhalt des Belegarztwesens - Änderungsvorschläge des BdB zum KHVVG-Entwurf wurden umgesetzt
Durch das geplante Krankenhausreformgesetz in seiner Entwurfsfassung nach Kabinettsbeschluss vom 15. Mai 2024 war das Belegarztwesen in seiner seit Jahrzehnten bewährten Form existenziell bedroht. Nach den Vorgaben des §135e im Gesetzentwurf hätten lediglich vier der insgesamt fünfundsechzig Leistungsgruppen durch Belegärzte erbracht werden können. Warum nur Augenheilkunde, HNO, MKG-Chirurgie und Gynäkologie für die Zulassung zur Leistungsgruppensystematik ausgewählt worden waren, war nicht nachvollziehbar. Vor allem war es nicht nachvollziehbar, warum alle anderen belegärztlichen Fachbereiche nach der Logik des Gesetzentwurfs auf die schlechter gestellten sogenannten intersektoralen Versorgungszentren nach §115g hätten beschränkt werden sollten. Diese Regelung hätte die eigentliche Zielsetzung des KHVVG, intersektorale Versorgung zu fördern, konterkariert, indem sie zahlreiche belegärztlich-fachärztliche Kompetenzzentren zum Verlassen des Belegarztwesens gezwungen hätte.
Stand 23.10.24
Pressemitteilung - personelle Neuaufstellung an der Spitze des Bundesverbandes der Belegärzte und Belegkrankenhäuser
Im Rahmen seiner diesjährigen Mitgliederversammlung in Kassel am 17. August legten Dr. med. Andreas Schneider, Urologe und bisheriger erster Vorsitzender des Bundesverbandes der Belegärzte und Belegkrankenhäuser (BdB), sowie Dr. med. Andreas Hellmann, Pulmologe und Schneiders Stellvertreter, ihre Ämter nieder. Schneider leitete den Verband sieben Jahre lang, Hellmann war seit neun Jahren als zweiter Vorstand im BdB akiv. Beide sind nicht mehr als Belegärzte tätig und wollen beruflich aktiven Kollegen den Vortritt lassen.
Stand 21.8.24
Nachfrage an den Bundesgesundheitsminister
Liebe Kolleginnen und Kollegen Belegärzte, liebe Vertreter und Sympathisanten des Belegarztwesens,
welch ein Gegensatz: Trotz mehrfacher und durchaus glaubwürdiger Versicherungen des BMG durch Staatssekretär Prof. Franke und auch durch Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach, die von uns vertretene patientenfreundliche, ressourcensparende, rechtssichere und zudem auch noch seit vielen Jahren praktizierte sektorenverbindende Versorgungsform solle unbedingt erhalten und ausgebaut werden, droht jetzt plötzlich das Gegenteil:
Im jüngst das Kabinett passierten Entwurf zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) Stand 15.05.24 (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz-khvvg.html) findet plötzlich nur noch in 4 von 65 Leistungsgruppen (LG) das Belegarztwesen Erwähnung (Augenheilkunde, MKG, Allgemeine Frauenheilkunde und HNO). Alle anderen LG wären somit nicht mehr belegärztlich verfügbar.
Diese Ankündigung war Anlass für uns, am 27.05.2024 einen offenen Brandbrief an Prof. Lauterbach zu senden, nachrichtlich an die Presse, den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, der DKG, dem SpiFa sowie weiteren Mandatsträgern im Gesundheitssystem und eine Korrektur zu fordern. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Brief. Den Brief finden Sie ganz unten.
Sofortige Reaktionen des Ministeriums innerhalb weniger Tage waren die Folge; mehrere Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMG (Fr. Sell, Fr. Dr. Wilke usw.) haben bereits stattgefunden; uns wurde eine Überprüfung des Gesetzentwurfes diesbezüglich zugesagt. Selbstverständlich werden wir weiterhin alle nötigen Schritte unternehmen, um die hier sich abzeichnende Beschädigung des Belegarztwesens zu unterbinden.
In diesem Zusammenhang bitten wir indes um Ihre Mitarbeit und Mithilfe: Bitte fordern Sie Ihre jeweiligen Fachgesellschaften auf, zu intervenieren und so den Druck auf die Korrektur des Gesetzentwurfes zu erhöhen. Leiten Sie den den Brief an die Multiplikatoren in Ihrem medizinischen Umfeld weiter.
Selbstverständlich werden wir Sie über den Fortgang unserer Maßnahmen informieren, insbesondere, wenn eine Stellungnahme des Ministers folgen sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas W. Schneider
Hier Brandbrief an den Bundesgesundheitsminister Lauterbach lesen.
Stand 10.6.24
„Am Ende sind das verschiedene Namen für das Gleiche“
Dr. Ryszard van Rhee plädiert dafür, die Systematik der schlechter bewerteten bDRGs komplett abzuschaffen
Vor Kurzem verkündete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass er eine neue Arztart einführen will, einen Behandler, der zwischen den Sektoren wandelt: den Hybrid-Arzt. Die Politik versuche, neue Verzahnungssysteme zu etablieren, ohne zu erkennen, dass die Belegärzte diese Aufgabe bereits rechtssicher erfüllen, kritisiert Dr. Ryszard van Rhee, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser, im Gespräch mit dem änd. Aus seiner Sicht müssen lediglich die Rahmenbedingungen für die Belegärzte angepasst werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Stand 24.5.24
Mehr sektorenübergreifende Versorgung: Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser (BdB) mit weitergehenden Vorschlägen zur Verzahnung von Krankenhäusern, Belegärzten und Vertragsärzten
Der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser (BdB) sieht Ansätze im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), die gemeinschaftliche Versorgung von Krankenhäusern, Belegärzten und Vertragsärzten zu stärken. Van Rhee, Vorstandsmitglied des BdB: „Wir sind davon überzeugt, dass eine stärkere gemeinschaftliche Versorgung weiterreichende Änderungen braucht. Dazu müssen zum einen Belegabteilungen aufgewertet und die Rolle der Belegärzte gestärkt werden, zum anderen muss der „Vertragsarzt in der stationären Versorgung" konzeptionell auf allen Ebenen in die Versorgung eingebunden werden."
Das klassische Belegarztwesen steht für eine institutionell verankerte gemeinschaftliche Versorgung beider Sektoren. Diese Versorgungsstruktur bietet optimale Voraussetzungen für eine stärkere Ambulantisierung und steht gleichzeitig für die erforderliche Flexibilität, auch in bevölkerungsarmen Gegenden mit geringem Patientenaufkommen eine stationäre Betreuung zu sichern. Um dieses Leistungsangebot zu stärken, schlägt der Verband folgende Maßnahmen vor:
Die nicht sachgerechten Unterschiede zwischen den Abteilungstypen entfallen; sie werden mit Blick auf die Vergütungskomponenten und Vergütungshöhen (Vorhaltevergütung und rDRG) und das Leistungsspektrum gleichgestellt. Zur Stärkung der konstitutiven Rolle von Belegärzten in Belegabteilungen sollen sowohl das Krankenhaus als auch Belegärzte bzw. zugelassene Medizinische Versorgungszentren nach Vorbild des § 115f (sektorengleiche Vergütung für Hybrid-DRG) Leistungen in Belegabteilungen abrechnen können.
Der BdB spricht sich zudem dafür aus, dass auch andere Vertragsärzte regelhaft auf allen Ebenen der Krankenhausversorgung und nicht nur in sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen (wie im KHVVG angedacht) einbezogen werden können. Als „Vertragsärzte in der stationären Versorgung“ sollen sie in zeitlich begrenzten Rahmen und als Vertragsärzte in Haupt- und Belegabteilungen versorgen können.
Der Verband steht mit seiner langjährigen Expertise bereit, die neue Versorgungsstruktur der Vertragsärzte in der stationären Versorgung konzeptionell und im Einzelfall zu unterstützen.
Die Stellungnahme des BdB zum KHVVG kann hier heruntergeladen werden.
Dr. Andreas W. Schneider
1. Vorsitzender BdB
Stand 02.05.2024
Nachfrage an den Bundesgesundheitsminister
Im April des vergangenen Jahres hatte Herr Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach im Rahmen eines persönlichen Gespräches im Ministerium zugesagt, nachhaltige Schritte zum Erhalt und Ausbau des Belegarztsystems in Deutschland einzuleiten (https://www.aend.de/articleprint/222760).
Der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser hat nunmehr die Initiative ergriffen und sich erneut an das BMG gewandt mit der Bitte, mitzuteilen, welche Maßnahmen zwischenzeitlich ergriffen wurden, diese sektorenverbindende, patientenfreundliche und ressourcensparende Versorgungsform auszubauen. Das Schreiben wurde gleichzeitig an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages weitergeleitet sowie an den ÄND.
Die Antwort des Bundesgesundheitsministers, Prof. Lauterbach, finden Sie unten.
Dr. Andreas W. Schneider
1. Vorsitzender BdB
Stand 22.4.2024
Breaking News
Aktuelle Nachfrage zum Belegarztwesen an Bundesgesundheitsminister Lauterbach (wir berichteten) löst eine „kleine Anfrage“ des Bundestages an die Bundesregierung aus. Die Antwort von Prof. Dr. Edgar Franke finden Sie unten.
Stand 12.4.2024
Wie kommen Belegärzte mit den Hybrid-DRG zurecht, Dr. van Rhee?
Die Einführung der Hybrid-DRGs zum 1. Januar 2024 hat vielmehr zu zahlreichen Fragen und weniger zum beabsichtigten erfolgreichen Ambulantisierungsanreiz geführt. Im Interview mit der Ärzte Zeitung beantwortet Dr. van Rhee, Vorstandsmitglied und Schatzmeister im BdB, aktuelle Fragen zum Themenkreis und stellt die besondere Position der Belegärzte als ideale Leistungserbringer dieser neuen Abrechnungsoption heraus.
Stand 19.3.2024
Demokratie und Pluralismus als Fundament für ein menschliches Gesundheitswesen
Der BdB e.V. unterstützt ausdrücklich einen gemeinsame Erklärung von Verbänden und Organisationen aus dem Gesundheitswesen:
Demokratie und Pluralismus sind Grundvoraussetzungen für ein Leben in Frieden und Freiheit. Sie sind elementar für das Wohlergehen unseres Landes und Fundament für das Zusammenleben und Zusammenwirken in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Miteinanders.
Stand 18.3.2024
Hybrid-DRG's werden die belegärztliche Welt ändern

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die „Verordnung über eine spezielle sektorengleiche Vergütung (Hybrid-DRG-Verordnung)“, die bereits zum 1.1.2024 in Kraft getreten ist. Absehbar werden Hybrid-DRG die belegärztliche Welt in mehrerlei Hinsicht ändern.
Der folgende Überblick zu den Regelungen der Hybrid-DRG führt die Kenntnisse zu Hybrid-DRG zusammen.
Weiterlesen
Autor:
Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn I Mitglied im BdB Vorstand
Stand 9.1.2024
BdB Pressemitteilung
Der Belegarzt als idealer Hybridversorger
Pressemitteilung (07.11.2023)
Das Konzept der Hybrid-DRG weist nach Auffassung des Bundesverbands der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e.V. (BdB) in die richtige Richtung und ist geeignet, die Ambulantisierung voran zu
bringen. Anlässlich der Jahrestagung des BdB analysierte der Vorstand mögliche Auswirkungen für das Belegarztwesen.
Weiterlesen
Belegarztanerkennung und Entfernung von der Klinik
Entscheidung des Landessozialgericht Schleswig-Holstein

Ein Bericht von Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn (09.11.2023)
Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein (Az L 4 KA 49/18 R) hat die Anforderung für Belegärzte noch mal höhergeschraubt.
Weiterlesen
Hybrid-DRG bringen Ambulantisierung auf den Weg
Belegarztwesen als idealer Hybridversorger
Ein Artikel von Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn und Dr. med. Andreas W. Schneider (26.10.2023)
Das Ministerium hat jüngst den Verordnungsentwurf zur Hybrid-DRG nach § 115f* vorgelegt. Nicht nur Krankenhäuser, Vertragsärzte und MVZ, sondern auch Belegärzte sind explizit zur Erbringung und Abrechnung berechtigt: Hybrid-DRG sehen eine gleiche Vergütung unabhängig davon, ob die vergütete Leistung ambulant oder stationär erbracht wird, vor. Es handelt sich um Komplexpauschalen, die die gesamte ärztliche Leistung (bei Operationen also i.d.R. mindestens Operateur und Anästhesist), Krankenhausleistung und Sachkosten umfassen.
„Belegarzt-Praxen in Not“
ALARMSTUFE ROT: STOPPT DAS KRANKENHAUSSTERBEN!

Der BdB unterstützt ausdrücklich den Protesttag der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte
am 02.10.2023 sowie die Aktionen der Krankenhäuser, denn wir sind doppelt betroffen.
Bildmotive Protestaktion zum Download: https://www.praxisinnot.de/3/mitmachen/
SpiFa Homepage: https://spifa.de
DKG Homepage: https://www.dkgev.de
Belegärzte und Krankenhäuser fordern mehr intersektorale Kooperation im Gesundheitswesen
DKG zu gemeinsamen Positionen mit dem BdB

Gemeinsame Pressemitteilung DKG & BdB (03.05.2023)
Der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser (BdB) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) haben gemeinsame Positionen formuliert, um die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern.
Weiterlesen
Bundesverband der Belegärzte und -krankenhäuser trifft Bundesgesundheitsminister
Lauterbach will Belegarztwesen im Zuge der Krankenhausreform stärken
Pressemitteilung (05.04.2023)
Für den Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e.V. (BdB) kommen positive Signale aus Berlin: Bei einem Treffen des BdB-Vorstands mit Prof. Dr. Karl Lauterbach am 3. April 2023 im Bundesgesundheitsministerium sprach sich der Minister für den Erhalt des Belegarztwesens aus, das als ergänzendes Versorgungssystem von hoher Qualität auch in der anstehenden Krankenhausreform berücksichtigt und gefördert werden solle.
Weiterlesen
Kontextfaktoren des AOP-Vertrags
Dauert's vielleicht noch

Ein Artikel von Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn (12.04.2023)
Nach dem seit 1.1.2023 geltende AOP Vertrag müssen im Katalog gelistete OPS grundsätzlich ambulant durchgeführt werden - es sei denn, es greift einer der (sehr restriktiv gefassten) patientenbezogenen Kontextfaktor. Scheinbar sind diese Eckdaten noch nicht scharf geschaltet.
Weiterlesen
Streitpunkt Leistungsgruppen
Level – mehr als nur akademischer Streit

Ein Artikel von Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn (12.04.2023)
Die künftige Krankenhauslandschaft wird auch davon geprägt sein, wie sich Bund und Ländern zu sogenannten Leveln und Leistungsgruppen einigen. Die Folgen für das Krankenhauses reichen von Erhalt des Status quo über Verlust einzelner stationärer Abteilung, Schrumpfung des anbietbaren Leistungs-spektrums in fortbestehenden Abteilungen und - im schlimmsten Fall - einer Rückstufung des gesamten Hauses auf ein ambulantes Gesundheitszentrum mit Pflegebetten. Die Debatte, so kompliziert sie ist, hat damit potentiell große Auswirkungen.
Weiterlesen
Neuer AOP-Vertrag
Umgang mit erschwerter Begründung für stationäre Durchführung

Ein Artikel von Priv.-Doz. Dr. rer. medic. Ursula Hahn (28.02.2023)
Eine wesentliche Änderung laut neuem AOP-Vertrag (am 22.12.2022 veröffentlich, am 1.1.2023 in Kraft getreten) betrifft die Begründung stationärer Durchführung von im AOP-Katalog gelisteten Operationen und Prozeduren (OPS). Nach bisherigem AOP-Vertrag konnte eine OPS ambulant oder stationär durchgeführt werden, OPS der Kategorie 1 „i.d.R. ambulant“ wurden mehrheitlich ambulant, die der Kategorie 2 „sowohl ambulant wie stationär“ öfters stationär durchgeführt. Nunmehr sind alle OPS des AOP-Katalogs grundsätzlich ambulant zu erbringen, nur ein patientenindividueller Kontextfaktor kann eine stationäre Durchführung begründen (§ 8 AOP-Vertrag neu).
(Belegarzt-)Praxen in Not
Die Ressourcen im Gesundheitssystem sind aufgebraucht

www.praxisinnot.de
SpiFa Kampgne (2023)
Die Ressourcen im Gesundheitssystem sind aufgebraucht, die Verteilung der Mittel gestalten sich zunehmend fragwürdig. Demographie von Patienten und Ärzteschaft, medizinischer Fortschritt in Diagnostik und Behandlung sowie zunehmende Individualisierung der Therapie lassen die Gesundheitsausgaben steigen. Brandbeschleuniger wie Covid-Pandemie, Lieferkettenengpässe, Klimawandel, Ukraine-Krieg, Energiekrise, massiv steigende Inflation sowie zunehmende Überlastung der Leistungserbringer in Pflege und ärztlicher Tätigkeit lassen das Rad immer schneller drehen.
Handlungsbedarf der Krankenkassen und Politik Veränderungen zu gestalten ist nachvollziehbar und erforderlich. Aber...
Kontakt
Geschäftsstelle Berlin des
Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser e. V.
Joachim-Karnatz-Allee 7
10557 Berlin
Jetzt Mitglied werden
Als Mitglied profitieren Sie von allen Vorteilen, die der BdB bietet, und unterstützen die berufspolitische Arbeit der Belegärzte.